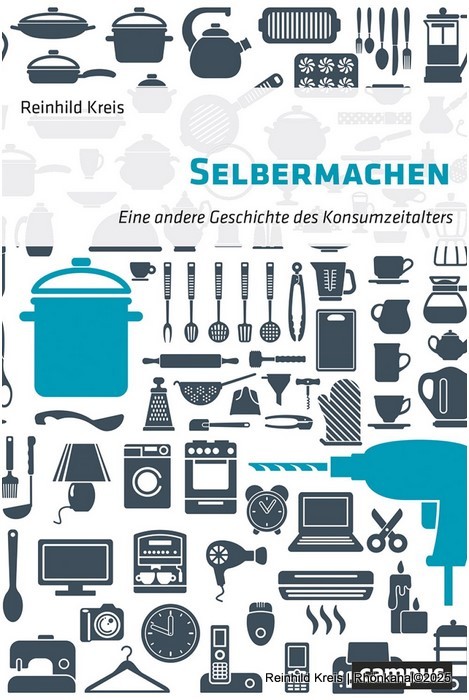Gastbeitrag von Wolfgang Weber
Hämmern, basteln, backen, bauen – Respekt, wer’s selber macht! So suggeriert es ein weithin bekannter Werbeslogan. Warum machen Menschen vieles selbst, was sie auch kaufen könnten?
In ihrem Vortrag in der Gedenkstätte Point Alpha unternahm Prof. Dr. Reinhild Kreis eine Zeitreise in die Geschichte des Heimwerkens oder Do-it-yourself (DIY) als Versorgungsstrategie. Dabei öffnete sie dem Publikum den Blick für die damit verbundene politische und kulturgeschichtliche Dimension.
Wer machte was selbst – und warum? Das scheint auf den ersten Blick banal, waren Praktiken des Selbermachens vom Kuchenbacken bis zur Fahrradreparatur in der deutsch-deutschen Vergangenheit meist im Alltagsleben angesiedelt.
„Wie Haushalte sich mit Waren und Dienstleistungen versorgen, ist aber keine (reine) Privatsache“, stellte die in Fulda geborene und aufgewachsene Referentin auf Einladung der Point Alpha Stiftung fest.
„Kaufen oder Selbermachen: Grundlage für die Entscheidung zwischen beiden Möglichkeiten ist, wie man die Ressourcen Zeit, Geld, Material und Werkzeug gewichtet und einsetzt.“
Ob Kleidung, Essen oder Wohnen – trotz oder gerade wegen des Lebens im Überfluss legten immer mehr Menschen selbst Hand an. Historisch gesehen ließen sich einige Wegmarken erkennen, die dem heutigen Trend vorausgegangen sind.
In diesem Hinblick sei der Vergleich zwischen „Selbermachern“ in den beiden deutschen Staaten ertragreich, da sie unter gänzlich anderen Logiken „prosumierten“ – eine Vokabel, die Kreis für die Definition „Selbermachen“ aus den Verben „produzieren“ und „konsumieren“ zusammensetzt. Prosumenten sind also Leute, die etwas kaufen – also konsumieren –, um etwas selbst herzustellen.
Malern, nähen, einwecken – etwas selbst tun, war für viele Menschen lange lebensnotwendig. Mit der Industrialisierung entwickelt sich das Feld vor allem im Westen zunehmend zum „Hobby“, eine Steuerung durch die Politik war eher schwächer ausgeprägt.
Wesentlich erfinderischer, kreativer und improvisationsfreudiger waren die Menschen dagegen in der DDR, die sich gezwungenermaßen mit der Planwirtschaft arrangieren mussten. Aus Mangel an Material wurde im Osten viel mehr umgenutzt oder weiterverwertet. Da verwandelte sich ein Komet-Haarscheidegerät mit ein paar Handgriffen flugs in eine Bohrmaschine.
Das SED-Regime forcierte das private oder kollektive Selbermachen mit Aktionen und Wettbewerben, um vorgegebene Plan-Ziele zu erreichen. Das Knobeln und Basteln in der Freizeit wurde als nützlich für die Gesellschaft, Solidarität oder als Gewinn für die Volkswirtschaft propagiert.
Und wer bei der Renovierung des Wohnumfeldes besonders fleißig war und an die Gemeinschaft dachte, dem wurde das Ehrenabzeichen für vorbildliche Nachbarschaftshilfe verliehen.
Das Phänomen Kaufen und Selbermachen hat aber auch noch andere Aspekte wie Kreis im Haus auf der Grenze anschaulich darlegte: Da spiele zum Beispiel die Frage der Identität eine Rolle, was zum Beispiel einen „richtigen“ Mann ausmache oder ob man Kinder erziehe, die sich selbst zu helfen wissen, ob man ein Geizkragen, ein guter Gastgeber oder eine umweltbewusste Person sei.
Auch in der Geschlechterordnung sei die Metapher vom zupackenden Mann und der mit Bewunderung zuschauenden Frau gerne genutzt worden. Heimwerker aktivieren zudem ihre Gefühlswelt, verspüren Freude und Glück nach getaner Arbeit und können mit Stolz das Werk der Familie und Freunden präsentieren, heben das Selbstwertgefühl oder protestieren leise gegen den Konsumwahn.
Auch der Marktwert eines Mannes bei der Partnerwahl habe steigen können, wenn man(n) handwerkliches Geschick nachweisen konnte.
Selbermachen lässt sich nicht ohne Weiteres in eine Schublade einordnen, zieht Prof. Dr. Kreis ein Fazit, aber die Entscheidung zwischen Kaufen und Selbermachen prägt unsere Wirtschaft und Gesellschaft mehr als uns bewusst ist.
Im Anschluss beantwortete Kreis die zahlreichen Fragen der Zuschauer. Zu Beginn hatte Philipp Metzler, Vorstand der Point Alpha Stiftung, ins Thema eingeführt und die Vortragende, die den Lehrstuhl für Geschichte der Gegenwart an der Universität Siegen innehat, vorgestellt.
Prof. Dr. Reinhild Kreis studierte Neuere und Neueste Geschichte, Bayerische Landesgeschichte. Ihr Habilitationsprojekt untersuchte „Selbermachen im Konsumzeitalter. Werte, Ordnungsvorstellungen und Praktiken vom ausgehenden 19. Jahrhundert bis in die 1980er Jahre”.
Die Ergebnisse der Studie sind in Buchform mit dem Titel „Selbermachen. Eine andere Geschichte des Konsumzeitalters“ im Campus-Verlag erschienen.