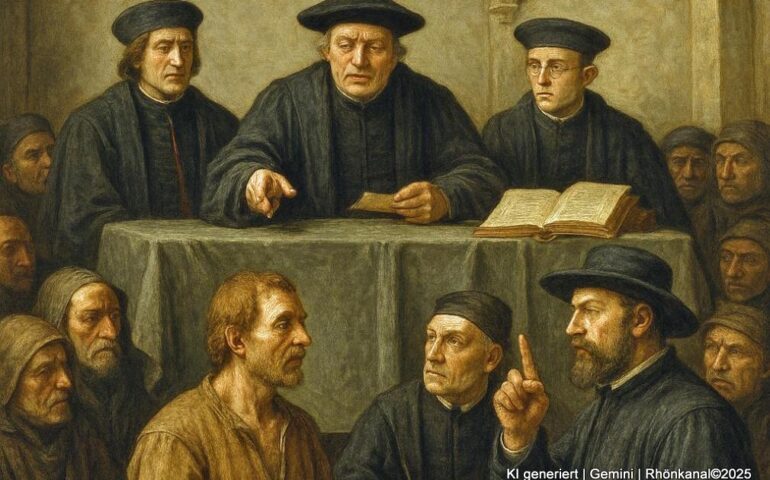Gastbeitrag von Siegfried Hartmann
Die Zentgerichte gehen auf die fränkische Zeit (8.–9. Jahrhundert) zurück. Der Begriff „Zent“ (auch „Cent“) bezeichnete ursprünglich eine Hundertschaft, also eine Verwaltungseinheit aus hundert Siedlungen oder Höfen.
Der „Zentgraf“ war ein vom Grafen eingesetzter Richter, später oft Reichsbeamter. Zentgerichte entwickelten sich aus den karolingischen Gaugerichten und bildeten die Grundlage für Hoch- und Blutgerichte des Mittelalters.
Hohe und niedere Gerichtsbarkeit
Man unterschied zwischen:
- Hoher Gerichtsbarkeit (Blutgericht): Zuständig für schwere Verbrechen („vier hohe Rügen“):
- Mord
- Notzucht
- Brandstiftung
- Diebstahl
Hinzu kamen je nach Region Delikte wie Ehebruch, Verrat, Ketzerei, Falschmünzerei, Raub und schwere Körperverletzung. Strafen reichten bis zur Todesstrafe.
Niedere Gerichtsbarkeit: Umfasste kleinere Vergehen und Ordnungswidrigkeiten: Beleidigungen, Nachrede, Grenz- und Feldfrevel, Holz- oder Viehdiebstahl, Zerstörung von Fluren, Wilderei, aber auch zivilrechtliche Streitigkeiten (z. B. Erbsachen, Nutzung von Gemeindewald und Wasser).
Aufbau und Ablauf
Das Zentgericht tagte meist unter freiem Himmel an traditionellen Gerichtsstätten („Thingplätzen“).
- Zentgraf: Vorsitzender, vom Landesherrn eingesetzt.
- Schöffen: Geschworene, die Recht sprachen („weil Recht schöpfend“).
- Heimbürgen/Beisitzer: Vertreter der Orte des Zentbezirks.
- Umstand: Das Volk, das den öffentlichen Charakter der Verhandlung garantierte.
Das Verfahren war formalisiert: Anklage, Beweisaufnahme, Zeugen, Geständnisse, Eidesleistungen, Urteilsfindung. Besonders im Spätmittelalter gewann die Schriftlichkeit (Aktenführung, „Urgichten“) an Bedeutung.
Zentgerichte als Herrschaftsinstrument
Der Besitz von Zentgerichten war für die Landesherren entscheidend, da er:
- ihre Landeshoheit sicherte,
- ihnen Finanzeinnahmen (Bußen, Gebühren, Kosten der Verurteilten) brachte,
- als Machtinstrument gegen widerständige Grundherren diente.
Ein Landesherr ohne Zentgericht war in seiner Stellung gefährdet, da er weder die volle Gerichtshoheit noch die politische Obergewalt behaupten konnte.
Wandel im Spätmittelalter und in der frühen Neuzeit
Mit der Ausbildung territorialer Fürstentümer ging die Gerichtsbarkeit zunehmend auf Ämter über.
Die „Peinliche Halsgerichtsordnung“ Kaiser Karls V. (Constitutio Criminalis Carolina, 1532/1535) vereinheitlichte Strafnormen und schrieb Folterverfahren sowie den Ablauf von Strafprozessen verbindlich fest.
Zentgerichte blieben bestehen, doch ihre Verfahren wurden stärker kontrolliert, Akten mussten an Kanzleien, Universitäten oder landesherrliche Räte übermittelt werden. Damit verloren sie ihre frühere Selbständigkeit.
Besonderheiten in der Rhön
Zent Friedelshausen, Kaltennordheim, Mellrichstadt, Fladungen und andere waren über Jahrhunderte zentral für die Rechtsprechung.
In Kaltennordheim und Kaltenwestheim sind zahlreiche Fälle überliefert, darunter Mord, Notzucht, Brandstiftung, Diebstahl und Hexenprozesse.
In Mellrichstadt und Fladungen hatten die Zentgerichte bis ins 17. Jahrhundert Bestand, ehe sie schrittweise aufgelöst wurden.
Geisa und Vacha zeigten besonders starke Einflüsse der „Peinlichen Halsgerichtsordnung“.
Niedergang und Ende
Im 17. und 18. Jahrhundert wurden die Kompetenzen der Zentgerichte stark eingeschränkt:
- Todesurteile durften oft nur noch verkündet, nicht mehr gesprochen werden.
- Polizeivergehen, Ordnungssachen und geringere Delikte gingen an Orts- und Patrimonialgerichte.
- Ab dem 18. Jahrhundert übernahmen die Ämter zunehmend alle gerichtlichen Aufgaben.
Mit der Revolution von 1848 wurden die letzten Patrimonialgerichte aufgehoben. Verwaltung und Justiz wurden getrennt, die Zentgerichte verschwanden endgültig.
Fazit
Die Zentgerichte der Rhön waren über Jahrhunderte das zentrale Instrument der Rechtsprechung und Landesherrschaft. Sie regelten sowohl schwerste Verbrechen mit Todesstrafen als auch alltägliche Konflikte des Dorflebens.
In ihrer Entwicklung spiegeln sich der Übergang von der alten Volksgerichtsbarkeit über die territorialstaatliche Zentralisierung bis hin zur modernen Gerichtsorganisation wider.